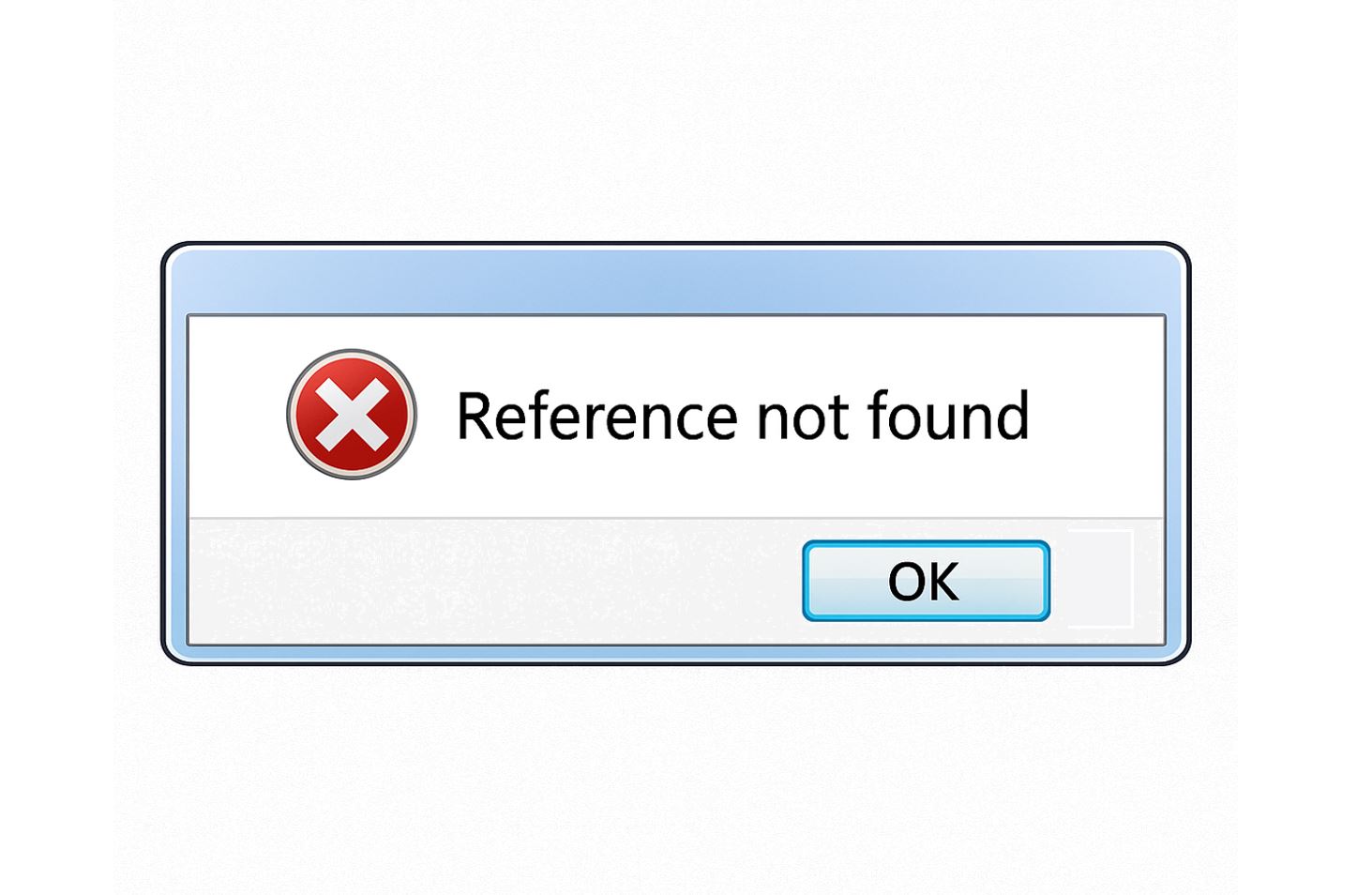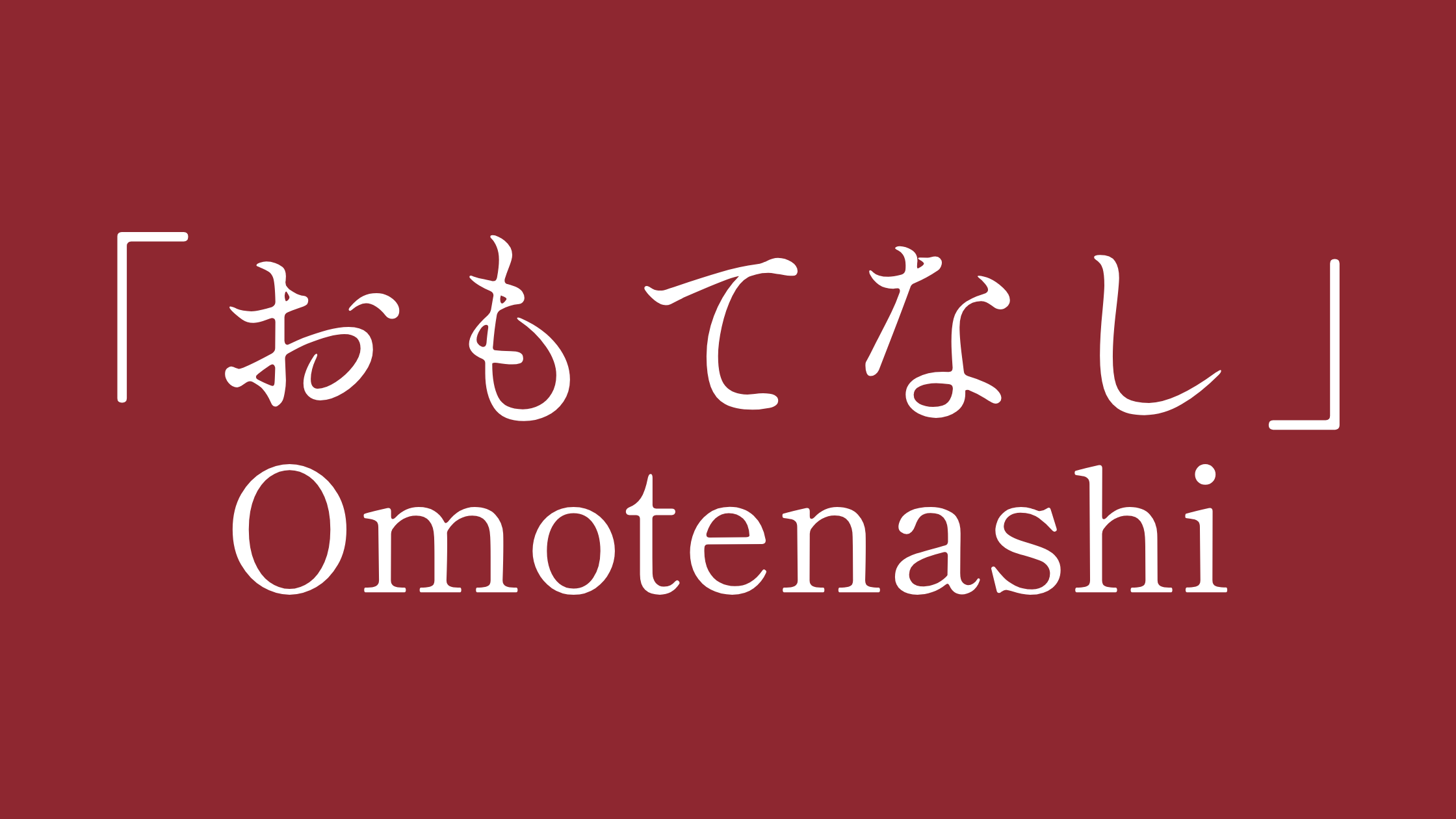(Dies ist Teil 3 der Serie „Global Management Essentials“)
In dieser Reihe Konzepte werden beleuchtet, die auf den ersten Blick klar und eindeutig wirken, jedoch in unterschiedlichen Kulturen oft sehr unterschiedlich interpretiert werden können.
In den ersten beiden Teilen haben wir Themen wie Escalation und die Rolle von Führungskräften bei Kündigungen behandelt. Dieses Mal wenden wir uns dem Konzept des Micromanagements zu.
Kürzlich führte ich ein interessantes Gespräch mit einem europäischen Vice President. Er erzählte mir, dass der President, ein japanischer Expatriate, häufig betone, dass er kein Micromanagement betreiben wolle, dann aber regelmäßig sehr detaillierte Informationen zu allen möglichen Themen aus verschiedensten Abteilungen anfordere und sichte.
Dieser scheinbare „Widerspruch“ wirft eine wichtige Frage auf:
Bedeutet Micromanagement für alle Business Cultures dasselbe?
Hier als Referenz die englische Definition:
Wikipedia (EN):
Micromanagement is a management style characterized by an excessive focus on observing and controlling subordinates and an obsession with details. It generally has a negative connotation, suggesting a lack of trust and too much focus on details instead of the “big picture.”
Interessanterweise ist die japanische Definition auf Wikipedia nahezu identisch. Der Unterschied scheint also weniger im Begriff selbst als vielmehr in der Interpretation zu liegen.
2. Warum japanische Führungskräfte ihr Verhalten oft nicht als Micromanagement sehen
In der traditionellen japanischen Geschäftskultur ist es üblich, dass Führungskräfte detaillierte Berichte aus allen Abteilungen erwarten (also auch aus solchen, die sie nicht direkt führen).
Diese Praxis beruht auf dem Horenso-Prinzip (報・連・相):
- 報告 (Hōkoku) – Berichterstattung
- 連絡 (Renraku) – Informationsaustausch
- 相談 (Sōdan) – Rücksprache / Konsultation
Horenso bedeutet übrigens „Spinat“ auf Japanisch und ist ein Beispiel für die Tendenz zur „Verniedlichung“ von Konzepten, da diese Doppeldeutigkeit bewusst genutzt wird, wenn neue Mitarbeitende geschult werden.
Dieses Prinzip erfordert durchgehende Transparenz durch alle Bereiche, um möglichst vielen in der Organisation einen umfassenden Überblick über laufende Entwicklungen zu ermöglichen. Besonders in den Niederlassungen bedeutet das auch, dass die Zentrale rechtzeitig informiert werden muss. (s.a. Escalation)
Aus dieser Perspektive ist das Anfordern von Detailinformationen kein Kontrollinstrument, sondern Ausdruck verantwortungsvoller Führung: „Ich möchte informiert sein, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.“
Solange Führungskräfte sich nicht einschalten, um konkrete Anweisungen geben, sehen viele Japaner ihr Verhalten nicht als Micromanagement.
„Im Bilde sein, was in der Organisation passiert“ gilt als sinnvolle Risikoprävention und nicht etwa als Einmischung.
3. Alles nur ein Missverständnis?
Im globalen Geschäftsumfeld ist die Unterscheidung zwischen „Ich frage nur, wie ihr XYZ machen werdet“ und „Bitte mach es genau auf diese Weise“ nicht immer eindeutig.
Wenn eine japanische Führungskraft kleinste operative Details verfolgt, die andere Executives ihren Teams überlassen, kann das Verhalten als mangelndes Vertrauen, Anzweifeln der Kompetenz und übermäßige Einmischung auf operativer Ebene gedeutet werden.
Häufig führt dies auch dazu, dass japanische Führungskräfte jeden Tag extrem lange arbeiten müssen, um all diese Details nachzuverfolgen.
Dies kann – trotz guter Absicht – als ineffizient eingestuft werden, denn das Ziel mag Risikovermeidung sein, aber das Verhalten ähnelt aus der Sicht der lokalen Teams klassischem Micromanagement.
4. Ein paar Tipps für beide Seiten
Für japanische Führungskräfte:
Zwei Grundsätze sind besonders wichtig:
- „Time is money“
Führungskräfte sollen sich auf strategische Themen konzentrieren, denn fürs Klein-Klein ist ihre Zeit zu schade. (und das Gehalt zu teuer...) - „Provide specialists with ownership of work“
Häufiges Anfordern von unwichtigen Details kann leicht als mangelndes Vertrauen interpretiert werden, ganz unabhängig von der eigentlichen Intention.
Für nicht-japanische Kolleginnen und Kollegen:
Den kulturellen Hintergrunds zu verstehen hilft, Missverständnisse zu vermeiden:
- Horenso zielt auf Transparenz, nicht auf Kontrolle ab.
- Detaillierte Berichte (und CC Mails...!) sollen Risiken verringern, nicht Autonomie einschränken.
- Nachfragen und Monitoring sind im japanischen Kontext kein Zeichen von Misstrauen.
Für beide Seiten:
Ein offener Austausch über gegenseitige Erwartungen, Anforderungen ans Reporting (z.B. vom HQ vorgegeben) und eine Definition von „appropriate involvement“ ist unerlässlich, um Missverständnissen vorzubeugen und darüber hinaus Effizienz und Vertrauen zu steigern.
Japan Consulting Office (JCO) bietet angepasste Workshops an, die japanische und nicht-japanische Teams, Manager/innen und Führungskräfte dabei unterstützen, kulturellen Feinheiten wie diese besser zu verstehen und gemeinsame Standards zu entwickeln.